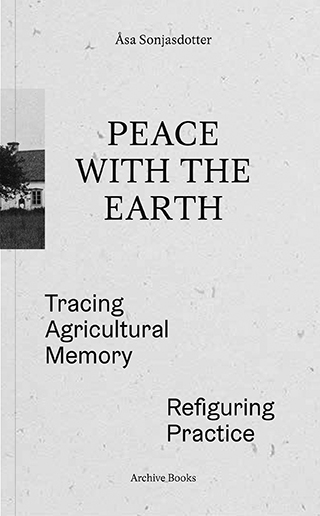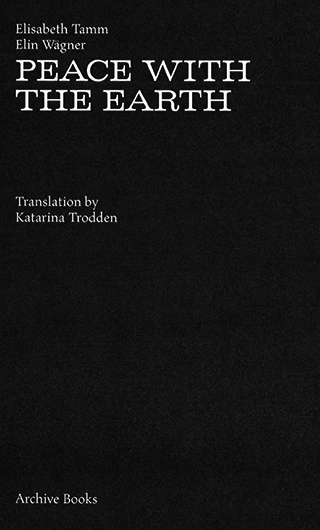Julia Bar-Tal is a farmer in the Märkisch-Oderland district of Brandenburg and a member of the nonprofit Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V. (AbL: Working Group for Rural Agriculture). This article first appeared in German on the AbL Website. Translation by Julie Niederhauser. Republished with the author’s permission.
Why this article?
I decided to write this article in an attempt to bring a voice of encouragement and cohesion, as well as a voice from the farming community, to the table, given the fear and confusion now being experienced by so many.
There is a simple explanation why I am writing as a farmer: when we as a society come under such enormous pressure that it raises existential questions, like the spread of the COVID-19 pathogen is doing, we have to reflect on what we really need in such a crisis.
We must think about how we can act in solidarity and for everyone’s benefit, even in difficult times. The most essential things to my mind are above all medical care and the supply of healthy and sufficiently abundant food, as well as a transparent flow of information that is comprehensible for everyone.
I will deal among other things, with possible reasons for the outbreak of epidemics such as corona, initially raising structural questions and then offering practical considerations. In this context, I will deal with how we can help each other and what is important from the point of view of regional agriculture, the main task of which is to contribute to the food supply.
It is about the questions I think we need to be addressing. It is infuriating when powerful people in politics, business and government use the crisis to advance their personal political agendas.
At the same time, it comes as no surprise. Economic aid is swiftly promised to large corporations, while at the same time the burden of lost work is borne by workers. It could be a political agenda directed against the population – even after corona – to prop up a system that does not provide universal health coverage, as in the USA, for example.
That, coupled perhaps with a lack of labor-law protections, means that many people do not dare to get themselves tested, or they continue to work despite being sick. Repressive regimes and some neoliberal western governments have often denied the onset or downplayed the danger of the coronavirus outbreak in their countries, thereby helping to spread it on a much larger scale without taking any action.
To disclose my political agenda up front: even though I personally am an organic farmer, this article is explicitly not about promoting the kind of organic farming I support, but rather about all of us in regional agriculture.
A crisis like the one with which we are now confronted shows us incredibly clearly that much of what we have taken for granted can quickly falter. It is high time that systemic relationships are questioned. Anyone who has not yet understood this may be able to see clear evidence of it right now during the current crisis. If they can’t understand this, they are beyond help.
Farmers have been drawing attention to their precarious economic situation for years. The loss of several thousand mostly medium-sized family farms in Germany every year for decades and the trend towards increasingly concentrated agricultural units, as well as towards the upstream and downstream sectors, are developments that we as a profession have so far been facing largely on our own and for which we receive little social attention.
The “grow or perish” principle affects our industry on a large scale and has long been a bitter reality. For many of us, this means loss and poverty – and countless personal fates of farmers. In France, an average of one farmer a day commits suicide.
We know that our markets are incredibly dependent on a flow of goods that must constantly grow. The free-market economy creates an intensification of agriculture to which farmers fall victim – and nature, the environment and biodiversity right along with them.
As our regional agriculture in Europe, Germany and Brandenburg has increasingly lost the character of small-scale farming, we farmers have consequently lost our existence. This means that we have been forced into a situation in which many of my colleagues can only survive if they switch to this type of production and go along with the trend towards intensification. Agriculture in our region is increasingly geared towards farmers producing for the world market instead of for regional supply, with all the disadvantages that this entails.
Buyer prices are now so bad that even farms with a few hundred dairy cows can no longer be maintained. Land cultivation in Brandenburg hardly yields any profit; a lack of processing structures in the region means that there is no purchaser for many products, or that a few retail customers can simply set the lowest prices thanks to their market power.
Wherever this kind of market concentration happens, farms automatically take a hit – as does biodiversity. There can be no broad and diverse crop rotation in the fields of Brandenburg unless there is also an equally broad and diverse purchasing structure.
Instead of strengthening our regional agriculture, we have relied on imports. Much of what could be cultivated here is imported more cheaply from elsewhere. Much of what we take for granted in stores is brought to us every day in containers by sea, road, rail and even by air.
In other words, we import the fruits of others’ exploited labor every day while at the same time sacrificing our own operating structures. To name just two examples familiar to most non-farmers: instead of growing enough legumes at home, we import three million hectares of soya for livestock farming each year from Latin America alone. Instead of relying on domestic oleaginous fruits, there are hardly any products that do not contain palm oil.
Regarding COVID-19, there is a heated debate whether it was pangolins or bats that brought us the virus. But simply looking for the original host that transmitted the virus to us falls far short of the mark. The questions are: why are these types of infectious diseases becoming more common, and why are they able to spread so rapidly across the globe?
The mode of transmission is already well known and probably requires no detailed explanation here. We know that our planet is circumnavigated millions of times each day by travelers and goods.
It is precisely here that the links with infectious diseases, such as those that are increasingly emerging, cannot be denied.
Some types of disease are transmitted by animals in agricultural production: these include not only avian and swine flu, but also MERS-CoV and other coronaviruses that have existed in the past. I mention both because it is important to me to argue objectively without making sweeping statements.
MERS-CoV was originally transmitted to humans from dromedary camels and was not the result of intensive animal husbandry. However, this also meant that this dangerous and fatal disease did not spread very rapidly and that the number of cases remained relatively low.
Avian and swine flu are far more dangerous in terms of disease propagation, because they are spread by animal species that are intensively farmed and bred, in conditions that hardly guarantee the genetic resistance or health of the animals. Intensive livestock production poses a great danger, not to mention the moral implications.
Recently, it has also become increasingly common for dangerous infectious viral diseases to be transmitted to humans from wild animals. But here too, the way we farm globally and the way we treat land and natural habitats play a central role.
One example of such an infectious disease is the Nipah virus, which caused a dangerous epidemic in Malaysia that killed 70% of those it infected. It could only be contained with drastic measures: culling more than a million pigs, over half of the Malaysian pig population.
Like many other pathogens, the origin of the Nipah virus can be traced: in this case, to bats. However, the actual habitat of these bats was the primary forests of Indonesia. After Indonesia cleared three-quarters of its forests for palm-oil production, the bats that lost their habitat moved to the fruit-tree plantations of neighboring Malaysia.
Here, pigs were infected and, primarily via workers in slaughterhouses, other people were infected as well. By endangering the vulnerable balance of ecosystems, humans also alter the transmission chains of viruses.
As evolutionary biologist Rob Wallace1 explains well, the outbreak of COVID-19 is not an isolated incident. The sudden increase and spread of this type of virus is closely linked to the way we organize our global food production, which in turn is linked to the profitability of multinational corporations.
An elementary component of their functioning is the rapid flow of goods and people around the globe. As Wallace goes on to describe, it no longer takes a long time to go from bats in the hinterlands of one continent “to killing Miami sunbathers.”
Infections transmitted by wild animals often only come to humans from pathogens that were previously hidden deep in natural habitats, because humans penetrate them. Genetic diversity is increasingly limited due to industrial agriculture’s intensification of genetic monocultures of specific species and breeds, as well as the destruction of naturally biodiverse habitats, with the result that there is a dwindling restraining effect to slow the spread of these kinds of viruses.
Professor Rodolphe Gozlan2, head of research at the IRD (Institute of Research for Development) in Marseilles, has noted: “Biodiversity is not something that humans can look at from the outside. Man is part of this diversity, whether he likes it or not. We scientists are aware of one thing: the protection of the environment or of biodiversity is not some romantic ideology; there is a very concrete link with the fight against infectious diseases.”
In short: global environmental protection is also global health protection.
In my view, the only answer to this can be real solidarity. The origin of the disease, the speed with which it can spread across the globe, as well as our means of countering its spread, can only be tackled together. It cannot be in our interest to look at and study individual outbreaks and regions only reactively and in a sensationalistic way.
For me as a farmer in the region, the facts that we produce too little for the region locally, that many well-trained specialists in our profession often only earn between EUR 1100-1300 net a month for a fulltime job in agriculture, and that farms are financially crippled even despite this self-exploitation, all go together.
For me, any discussion of solidarity must also include the fact that poorly paid cleaning staff working for a Charité Berlin subcontractor had to stop their strike because their work is so incredibly important – especially during the corona epidemic. Their strike was stopped for security reasons.
Nowhere in the discussion about corona and its consequences do I hear anyone advocating for all of these people, who are there every day to care for us, to immediately receive much higher salaries in recognition and, in the case of this outbreak, possibly even hazard pay.
The neoliberal restructuring of our health system on the basis of flat-rate payments per case, which has led to a situation in which a country as prosperous as Germany may not now have sufficient surplus capacity, is no different than what we see in agriculture and in many other working environments.
Whether it is overworked, tired, poorly paid caregivers who are accused of being unfriendly because they barely have the strength to respond to the many people they must care for, or farmers who across the board are accused of poor treatment of animals or nature – in essence, it’s the same problem.
In reality, the sick and the elderly are often treated unkindly, and it is also true that animals, soil and nature are often treated negligently. All of this happens within labor and marketing contexts that feature invoicing down to the euro/cent. The people who work in this sector are of course also affected. There is therefore no getting away from asking questions about the bigger connections and, as we do so, we should start from a basis of solidarity.
Our anger is not directed at workers, but at who sell us ever-increasingly intensive production as the only alternative, who make us dependent on large corporations. They and their demands are the ones responsible for making us all – whether in the global North or the global South – struggle for a world market that clearly brings us nothing but suffering and misery at both regional and global levels.
The agricultural industry is so blindly profit-oriented that even the “collateral damage” of short-sighted decisions inevitably made under the sole criterion of profit maximization can be as devastating as we are currently experiencing: a virus has emerged – and not by chance – a pandemic that could cost an incalculable number of people their lives.
COVID-19 is already having economic consequences that are raising comprehensive questions about these profits and – much more importantly! – everything that affects our lives. As long as “the shop” ran undisturbed by the virus, the externalized costs were borne virtually uncomplainingly and unnoticed by the animals, the environment, the agricultural workers, the consumers, the state, the healthcare system, and many more.
They have never been included in agricultural operating costs, and those responsible have never had to pay for them. Had that happened, this form of agricultural industry would not exist at all. Even now, with the immense costs caused by the coronavirus outbreak, that will not be the case. In the end, we will have to shoulder those costs.
This is all the more reason for us to see the current crisis at least as an opportunity to challenge these injustices once and for all and to look for ways to bring about profound change – together.
Racist exclusions cannot have any room in this discussion. Those who would allow them have not understood anything structurally, let alone the fact that they condone the violence racism represents. Healthy living conditions, good food and medical care are a universal right. In addition, the virus does not know these boundaries.
Anyone who would discriminate against and exclude others has therefore not understood that the risk of falling ill increases exponentially the worse these “others” are provided for in our global society. When it comes to diseases and epidemics, marginalized people have always been and are being stigmatized, victimized and – in the systemically unavoidable, barbaric competition for increasingly scarce resources – presented as a threat.
To put this briefly into context in relation to some of the infectious diseases of recent history: anti-Chinese racism related to the coronavirus epidemic is as wrongheaded as it is right to recall that the various avian and swine flu epidemics originated in Europe and the US, and that here, too, the governments covered for the agribusiness that was responsible. Regionally widespread diseases such as Ebola in West Africa and Zika in Brazil were greatly exacerbated by post-colonialist poverty and dependence on multinational exploiters.
Our own government resists with all its might a supply chain law that would make exploitation by German companies abroad a criminal offense. Conversely, this means that products produced under such conditions will continue to dominate our market, and that domestic producers will have to compete against these cheap prices while at the same time being economically ruined by them.
This is one prime example of how more unites us than divides us, across all borders of the globe and all differences in living and working conditions. The countries and people of the global North have long been the winners of these exploitative conditions, but the plight of the farmers and the people who are increasingly forced to slave away in precarious working conditions here as well shows that this injustice is also growing rapidly in the global North. Playing off marginalization against marginalization is a blatant ploy to divide us. We will not allow this to happen.
It is the same governments that, with the help of the employers’ organizations, have for years prevented the supply chain law and pushed for free trade agreements like Mercosur, who now, as part of the planned agricultural package, want to immediately enforce regulatory measures against farmers without giving them sufficient time or creating a framework to enable them to make the changes they need to make.
Protection against over-fertilization and a high use of chemical pesticides is essential for future-oriented agriculture. That is beyond question. However, it is cynical when politicians do not call into question the system that they have installed over decades in the interests of the agricultural industry, and expect farmers to be able to fix it on their own.
To take a regional example and put it in the context of the coronavirus crisis:
How do we intend to deal with a situation in which certain products are now becoming scarce, but we as a society know that short-term protection against the spread of the coronavirus is best achieved if people and products are not constantly moving from region to region?
In our region, a whole range of products have not been grown for a long time because there is a lack of processing capacity: fruit, vegetables, root crops like potatoes. We import the majority. Germany grows only 27% of its own vegetable requirements, because growing vegetables requires manual labor, often in combination with intensive use of pesticides, and all this can be done much more cheaply and with far fewer restrictions abroad.
We have created a system in which everything is simply imported if it increases short-term profits. These exploitative structures already impact the marginalized workers who toil in southern Spain for a large part of European vegetable production, including for German supermarket shelves. Due to the coronavirus crisis, the pressure on them to work is increasing immeasurably, with 15-hour-plus workdays being reported.
Labor struggles by the trade unions were interrupted there precisely because of the coronavirus, as were those at the striking Charité hospital in Berlin. Protective measures at work in terms of proper distancing or masks do not exist, even for workers in the packing halls. If they fall ill, the solidarity we have lacked for years could affect us in the form of a stagnating flow of goods or increasing numbers of infections. If the people who are in contact with the products we need to live are sick, our risk of getting sick increases.
Our region will also be severely affected by the losses that will occur in our special domestic crops due to unavailable (cheap) seasonal workers from abroad. The federal government has recently adopted an agricultural package that acknowledges the relevance of this workforce while at the same time further relaxing worker protection.
It is now permitted to employ seasonal workers for up to five months without making social security contributions. What is needed is a package that would financially support companies in employing people properly.
When will there be a change in thinking so that working people finally receive recognition and solidarity? How are we, as regional farmers, now supposed to quickly create structures to ensure our region is supplied? And yet that is our task, which we want to and shall fulfill with pride and passion.
We must try to ensure that, even in a crisis situation, all members of the population have access not only to durable dry goods but also to fresh produce rich in vitamins. Above all, fruit and vegetables provide vital immune power, which means that we need them more than ever.
If imports fail, these products will become scarce, and this will hit the poorer segments of the population first and foremost, who will lose access to them. We need to discuss how we can ensure that we do not just decide who gets what based on a profit motive, but that we create structures that are also based on solidarity.
Surely the COVID-19 pandemic has made clear by now how important regional agriculture is. The crisis must be used as an opportunity to ensure that farms are provided with all necessary means to continue to exist and operate in the short term. This must be implemented in part through guaranteed purchase prices and the creation of processing and distribution stations.
Transport drivers and sales staff involved in distribution must be properly remunerated. They are among those who – like those working in cleaning, emergency services, medical care and many other areas – are ensuring that we all get through these difficult times.
In the long term, it must become clear that it is regional added value that protects us all. It must be understood that the basis of our food supply, the agricultural land, belongs in the hands of regional farmers and not in the hands of investors and supra-regional or non-agricultural companies. This must apply to our region as well as to all other regions of the globe (or: all other regions worldwide). Agricultural land must not be an object of speculation, neither here nor in the global South.
We need an agrarian structure model and resulting consequences, which will lead to the emergence of a large number of young, sustainable and medium-sized farms in our region. We need targeted support for vocational training in the food-processing industry, coupled with the creation of a large number of companies in this downstream sector.
It is unacceptable that a lack of entire product categories in processing should mean that they are scarcely to be found in the region’s fields. Nor can it be the case that the market power of a few dairies or slaughterhouses leads to a situation where, in case of doubt, the supply of the population is not guaranteed, or where farmers are operating on the fringes of existence due to the price pressure arising from concentration.
Just as we must act locally and think globally, we must now, against the backdrop of this threatening disease outbreak, manage to act in solidarity in the short term and in the long term.
In the long term, the structural question must be asked and tackled in concrete terms. Otherwise, this outbreak of COVID-19 will continue to be treated and seen as an isolated event. We will endure the pain of loss and grief; we will at best take good care of each other, and afterwards politics and the media will return to the unspectacular everyday life of injustice – until the next catastrophe.
In the short term, we have to see to how we can now act as a community. Local initiatives for mutual support are already emerging in cities and smaller communities. Childcare, shopping, rides and much more are being offered in solidarity.
We as farmers in the region will do everything we can to fulfill our role for everyone during this time. In order to meet our responsibility, we will certainly also need some support here and there.
We need to realize that any further rapid spread of the virus, should it affect us and make us sick, can also lead to job losses in our sector. That in turn would put a strain on regional supply. So in no way is this commentary about us demanding greater protection than anyone else, or being in any way more vulnerable. It is, however, about considering when in doubt how we can minimize as far as possible the risk of infection across entire the value chain: from production on our farms, through processing, to the distribution of food.
It is also a matter of considering how we can keep our businesses afloat when the economy around us is falling apart. All of us in the region have already come under massive pressure as a result of the past several years of drought, not least because of decades of failed agricultural policy.
In Germany, thousands of farms are lost every year. The last few months have been marked by the justified protests of thousands of farmers. We, like the cleaning staff of Charité, will stop our protests so that we can ensure the food supply as we all face this difficult situation.
Many of us who farm have been working in this sector for a long time with a great deal of idealism and self-exploitation. Our work is taken for granted yet in reality this has not been the case for a long time. If food shortages occur due to a lack of imports, we will do everything we can to continue to produce good food for the people in our region.
I hope I speak on behalf of my entire profession when I say that we will not allow ourselves to be provoked by a situation of scarcity in to making our products available only to people with the requisite financial means. We will ensure that food is available to all people equally, regardless of financial resources, origin, education, language or culture. Our work will be driven by solidarity, not by profit.
We will have to consider even more urgently than we are already doing how to address the social issues surrounding food prices and accessibility, but we will need the support of the broader society to do it (with or without the coronavirus).
Greetings of solidarity to all of you:
to those working in the medical sector, including and explicitly also to cleaning staff and those doing vital work in similar areas; to those working in public transport and in transportation; to those in the skilled trades; to food vendors and pharmacists; to people in the education sector who are making sure that education continues to be available online; to people in childcare; to undocumented workers; to poor people; to lonely people; to immunocompromised people; to people with preexisting conditions and elderly people; to people who are trapped in contexts where social distancing for their own protection is not possible, such as in overcrowded refugee camps or in prisons; to children who cannot meet their friends and may not get out to play for a long time – and to their parents; to homeless people; to people in nursing homes, hospitals and hospices who are now without visitors; to people who get sick from the coronavirus and who lose people they love during this time; to people who are plunged into financial ruin by this situation; to people who are mentally ill or have difficulty dealing with the fear that such a situation engenders; to the workers who are unionized and those who are not and, of course, very warmly to all of my professional colleagues in agriculture.
- theleftberlin.com/post/what-are-the-causes-of-the-coronavirus
- arte.tv/de/videos/096140-000-A/umweltzerstoerung-beeinflusst-epidemien/
Original version:
Warum dieser Artikel? Ich habe mich entschlossen, diesen Artikel zu schreiben, um angesichts der Angst und Verwirrung, die gerade viele umtreibt, zu versuchen, eine Stimme der Ermutigung und des Zusammenhalts und auch eine Stimme aus der Landwirtschaft einzubringen. Warum ich als Landwirtin schreibe, hat eine einfache Erklärung: Wenn wir als Gesellschaft unter einen solch immensen Druck geraten, der ganz existenzielle Fragen aufwirft, wie die Verbreitung des Covid-19 Erregers es gerade tut, müssen wir uns auf das zurückbesinnen, was wir in einer solchen Krise tatsächlich brauchen. Wir müssen überlegen, wie wir gemeinsam und für alle auch in schwierigen Zeiten agieren. Das Essenzielle ist in meinen Augen vor allem die medizinische Versorgung, die Versorgung mit gesunden und ausreichenden Lebensmitteln, sowie einem transparenten und für alle verständlichen Informationsfluss.
Der Text wird sich unter anderem mit möglichen Gründen für den Ausbruch von Epidemien wie Corona beschäftigen, womit zunächst strukturelle Fragen aufgeworfen sind, um dann zu praktischen Überlegungen zu kommen. In diesem Zusammenhang wird es darum gehen, wie wir uns gegenseitig helfen können und was dabei aus Sicht der regionalen Landwirtschaft wichtig ist, deren Aufgabe vor allem darin besteht, ihren Teil zur Lebensmittelversorgung beizutragen.
Es geht darum, mit welchen Fragen wir uns meiner Ansicht nach in irgendeiner Form notwendigerweise auseinandersetzen müssen. Es macht wütend, wenn mächtige Menschen in Politik, Wirtschaft und Staaten die Krise nutzen, um persönlich-politische Agenden voranzutreiben. Gleichzeitig ist es auch keine Überraschung. Schnell werden Wirtschaftshilfen für Großkonzerne versprochen, während gleichzeitig die Last der ausfallenden Arbeit von den ArbeiterInnen getragen wird. Eine gegen die Bevölkerung gerichtete politische Agenda kann es – auch jenseits von Corona – sein, an einem System festzuhalten, das keine Krankenversicherung für alle vorsieht, wie es zum Beispiel die U.S.-Regierung tut. Das und eine womöglich fehlende arbeitsrechtliche Absicherung haben zur Folge, dass viele Menschen es nicht wagen sich testen zu lassen oder trotz Krankheit weiter arbeiten gehen. Repressive Regime und einige neoliberale westliche Regierungen haben häufig die Anfänge von Corona in ihren Ländern geleugnet oder die Gefahr hinuntergespielt und damit dazu beigetragen, dass eine Ausbreitung in viel größerem Ausmaß stattfinden konnte, ohne dass Maßnahmen ergriffen wurden.
Um auch meine politische Agenda vorweg zustellen: Auch, wenn ich persönlich Bio-Landwirtin bin, geht es in diesem Artikel explizit nicht darum, den von mir favorisierten Ökolandbau voranzubringen, sondern um uns alle in der regionalen Landwirtschaft.
Eine Krise, wie die, mit der wir uns jetzt konfrontiert sehen, führt uns mehr als deutlich vor Augen, dass vieles, worin wir uns als selbstverständlich eingerichtet haben, auch schnell ins Wanken geraten kann. Die Frage nach den systematischen Zusammenhängen muss schon lange gestellt werden. Wer das bis jetzt noch nicht verstanden hat, kann vielleicht gerade in der aktuellen Krise deutliche Hinweise dafür sehen. dem ist nicht mehr zu helfen.
Die LandwirtInnen machen seit Jahren auf ihre prekäre wirtschaftliche Lage aufmerksam. Der Verlust von mehreren tausend meist mittelständischen Familienbetrieben in Deutschland jedes Jahr und seit Jahrzenten und der Trend zu immer konzentrierteren landwirtschaftlichen Einheiten, sowie dem vor- und nachgelagerten Bereich sind Entwicklungen, denen wir bisher als Berufsstand meist allein gegenüberstehen und für die wir wenig gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekommen. Das Prinzip „wachse oder weiche“ betrifft unsere Branche in besonderem Maße und ist schon lange bittere Realität. Das bedeutet für viele von uns Verlust und Armut, ungezählte persönliche Schicksale von Bauern und BäuerInnen. In Frankreich ist in der Bauernschaft durchschnittlich ein Selbstmord pro Tag zu verzeichnen.
Wir wissen, dass unsere Märkte in einem unglaublichen Maß abhängig sind von einem Warenfluss, der stets wachsen muss. Die freie Marktwirtschaft kreiert eine Intensivierung der Landwirtschaft, der BäuerInnen zum Opfer fallen und im selben Atemzug Natur, Umwelt, Artenvielfalt.
Während unsere regionale Landwirtschaft in Europa, in Deutschland und in Brandenburg zunehmend den Charakter der bäuerlichen Landwirtschaft verloren hat und wir als BäuerInnen somit unsere Existenz, bedeutet dies auch, dass wir in eine Situation gedrängt wurden, in der viele BerufskollegInnen nur überleben können, wenn sie sich dieser Art von Produktion anschließen und ebenso in die Intensivierung gehen. Zunehmend wurde in unserer Region eine Landwirtschaft kreiert, in der LandwirtInnen für den Weltmarkt produzieren und nicht für die regionale Versorgung. Mit allen Nachteilen, die es auch für sie selbst bedeutet:
Die Abnehmerpreise sind inzwischen so schlecht, dass selbst Betriebe mit einigen hundert Milchkühen nicht mehr aufrechterhalten werden können. Der Ackerbau in Brandenburg bringt kaum noch einen Gewinn, die fehlenden Weiterverarbeitungsstrukturen in der Region bedeuten, dass es für viele Produkte gar keine Abnahme gibt oder die wenigen Abnehmer im Handel durch ihre Marktmacht einfach die niedrigsten Preise festlegen können. Wo diese Art von Marktkonzentration stattfindet, geht es Landwirtschaftsbetrieben automatisch schlecht, aber auch der Biodiversität. Es kann keine breite und vielfältige Fruchtfolge auf den Äckern Brandenburgs geben, wenn es nicht auch eine ebenso breite und vielfältige Abnahmestruktur gibt.
Anstatt unsere regionale Landwirtschaft zu stärken, wurde auf Import gesetzt. Vieles, was hier angebaut werden könnte, wird billiger von woanders importiert. Vieles, was wir im Laden als selbstverständliches Angebot betrachten, wird jeden Tag mit Containern über das Meer, über die Straße, über die Gleise und sogar durch die Luft zu uns gebracht.
Wir importieren uns also tagtäglich die Früchte ausgebeuteter Arbeitskraft anderer und gleichzeitig den Verlust unserer eigenen Betriebsstrukturen. Um nur zwei Beispiele zu nennen, die auch den meisten nicht-LandwirtInnen bekannt sind: anstatt ausreichend heimische Leguminosen anzubauen, importieren wir 3 Millionen ha Soja für die Tierproduktion jährlich allein aus Lateinamerika. Anstatt auf heimische Ölfrüchte zu setzen, gibt es kaum noch Produkte, die kein Palmöl enthalten.
In Bezug auf Covid-19 wird hitzig diskutiert ob es das Gürteltier oder die Fledermaus waren, die uns den Virus brachten. Das alleinige Betrachten des Ursprungswirt, über den der Virus zu uns gelangt ist, greift allerdings viel zu kurz. Die Frage ist, warum sich diese Art von Infektionskrankheiten häufen und warum sie sich so rasend schnell über dem Globus verbreiten können.
Wie sie sich verbreiten, ist bereits genügend bekannt und muss an dieser Stelle vermutlich nicht noch einmal erwähnt werden. Wir wissen, dass unser Planet jeden Tag millionenfach umrundet wird von Reisen und Transporten.
Gerade hier sind die Zusammenhänge zu Infektionskrankheiten, wie die, die sich zunehmend entwickeln, nicht zu leugnen:
Es gibt die Art der Krankheiten, die durch Tiere in der landwirtschaftlichen Produktion übertragen werden, wie die Vogel- oder Schweinegrippe, aber auch MERS-Cov und andere Corona-Viren, die es in der Vergangenheit gab. Ich erwähne beide, da es mir wichtig ist, sachlich und ohne Pauschalaussagen zu argumentieren. MERS-Cov hatte seinen Ursprung bei Kamelen und Dromedaren in der Übertragung auf den Menschen und nicht in der intensiven Tierhaltung. Allerdings hat das auch bedeutet, dass diese gefährliche und tödliche Erkrankung sich nicht so rasant verbreitet hat und die Fallzahlen relativ gering geblieben sind. Vogel- oder Schweinegrippe sind Erkrankungen, die in der Ausbreitung viel gefährlicher sind, da es sich um Tierarten handelt, die intensiv gehalten und produziert werden, unter Bedingungen, die die genetische oder gesundheitliche Resistenz der Tiere kaum noch gewährleistet. Intensive Tierhaltung stellt eine große Gefahr da, ganz abgesehen von den moralischen Implikationen.
Neuerdings kommt es auch immer häufiger dazu, dass gefährliche Infektionserkrankungen durch Viren von Wildtieren auf den Menschen übertragen werden. Doch auch hier spielt die Art, wie wir global Landwirtschaft betreiben und mit Land und natürlichen Habitaten umgehen, eine zentrale Rolle. Ein Beispiel für eine solche Infektionskrankheit ist das Nipah-Virus, das in Malaysia zu einer gefährlichen Epidemie mit 70%-iger Mortalitätsrate beim Menschen führte. Sie konnte nur mit drastischen Maßnahmen – Keulung von über einer Million Schweinen, also über der Hälfte des Malayischen Schweinebestands – eingedämmt werden konnte.
Das Nipah-Virus lässt sich wie viele andere Krankheiten zurückverfolgen: Ursprung war die Fledermaus. Diese Fledermäuse hatten jedoch ihr eigentliches Habitat in den Urwäldern Indonesiens. Nachdem Indonesien für die Palmölproduktion drei Viertel seiner Wälder gerodet hatte, waren die heimatlos gewordenen Fledermäuse auf die Fruchtbaumplantagen des benachbarten Malaysia umgesiedelt. Hier wurden die Schweine infiziert und primär über MitarbeiterInnen in den Schlachthöfen dann auch andere Menschen. Indem der Mensch das labile Gleichgewicht der Ökosysteme gefährdet, verändert er auch die Übertragungsketten der Viren.
Wie der Evolutionsbiologe Rob Wallace1 gut beschreibt, ist jeder weitere Ausbruch von Covid-19 kein isolierter Vorgang. Die sprunghafte Zunahme und Verbreitung dieser Art von Viren ist eng verbunden mit der Art, wie wir unsere globale Lebensmittelproduktion gestalten und diese wiederum mit der Profitorientiertheit multi-nationaler Unternehmen. Elementarer Bestandteil von deren Funktionieren sind die rasenden Flüsse von Waren und Menschen rund um den Globus. Wie Rob Wallace weiterhin beschreibt, ist es heutzutage kein weiter Weg mehr von der Fledermaus im Hinterland eines Kontinentes bis „zum Tod von sonnenbadenden Menschen in Miami“.
Auch die von Wildtieren übertragenen Infektionen kommen häufig erst aus vormals tief in natürlichen Habitaten verborgenen Erregern zum Menschen, weil der Mensch zu ihnen vordringt. Die genetische Vielfalt ist durch die agrarindustrielle Intensivierung einzelner Tierarten und -Rassen, sowie durch die Zerstörung der Habitate natürlicher Bio-Diversität zunehmend eingeschränkt, dass einer Verbreitung dieser Art von Viren immer weniger bremsende Wirkung entgegensteht.
Wie Professor Rodolphe Gozlan2, Forschungsleiter am Institut für Entwicklungsforschung sagt, ist „Artenvielfalt nicht etwas, was sich der Mensch von außen betrachten kann. Er ist Teil dieser Vielfalt, ob er will oder nicht. Wir Wissenschaftler sind uns über eines im Klaren: der Schutz der Umwelt oder der Artenvielfalt ist keine romantische Ideologie, sondern hier besteht ein ganz konkreter Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Infektionskrankheiten.“
Kurz gesagt: globaler Umweltschutz ist auch globaler Gesundheitsschutz.
Eine Antwort hierauf kann in meinen Augen nur wirkliche Solidarität sein. Der Ursprung der Krankheit, die Geschwindigkeit, mit der sie sich über den Globus verbreiten kann, ebenso wie unsere Möglichkeiten der Ausbreitung zu begegnen, sind nur in Verbindung anzugehen. Es kann nicht zielführend sein, die einzelnen Ausbrüche und Regionen nur reaktiv und sensationsgesteuert zu betrachten und zu behandeln.
Für mich als Landwirtin in der Region gehören die Tatsachen, dass wir vor Ort zu wenig für die Region produzieren, dass viele gut ausgebildete Fachkräfte in unserem Berufszweig für eine Vollzeitarbeit in der Landwirtschaft oft nur zwischen 1100-1300 Euro netto verdienen und dass die Betriebe trotz dieser Selbstausbeutung finanziell in Knie gehen, zusammen. Ebenso gehört für mich in die gleiche Diskussion der Solidarität, dass schlechtbezahlte Reinigungskräfte im Subunternehmen der Charité Berlin jetzt ihren Streik unterbrechen mussten, weil ihre Arbeit so unglaublich wichtig ist – gerade angesichts der Corona-Epidemie. Ihr Streik wurde aus Sicherheitsgründen unterbrochen. Bei all der Diskussion über Corona und die Folgen, sehe ich jedoch nirgendwo eine Diskussion darüber, dass sofort alle diese Menschen, die jeden Tag für unsere Versorgung da sind viel höhere Gehälter als Anerkennung bekommen sollten und im Falle dieses Ausbruchs eventuell sogar noch eine Gefahrenzulage.
Die neoliberale Umgestaltung unseres Gesundheitssystems nach Fallpauschalen, die dazu geführt hat, dass ein so wohlhabendes Land wie Deutschland nun womöglich nicht über genügend Überkapazitäten verfügt, ist nichts anderes, als das, was wir in der Landwirtschaft und in vielen Bereichen der Arbeitswelt sehen. Ob es überarbeitete, müde, schlecht-bezahlte Pflegekräfte sind, denen womöglich Unfreundlichkeit vorgeworfen wird, weil sie kaum noch die Kraft haben, auf die vielen von ihnen zu versorgenden Menschen einzugehen, oder LandwirtInnen, denen pauschal schlechter Umgang mit Tieren oder der Natur angekreidet wird: Es geht im Kern um das gleiche Problem.
Tatsächlich: es wird oft lieblos mit Kranken und Alten umgegangen, sowie es auch zutrifft, dass oft fahrlässig mit Tieren, Böden und der Natur umgegangen wird. Das alles geschieht in Arbeits- und Vermarktungszusammenhängen, bei denen im Euro/Cent-Bereich abgerechnet wird. Dabei geht es eben auch um die Menschen, die in dem Bereich arbeiten. Wir kommen also nicht darum herum, die Frage nach den größeren Zusammenhängen zu stellen, und während wir das tun, sollte Solidarität die Grundlage sein. Adressaten für unsere Wut sind nicht die Arbeitenden, sondern diejenigen, die uns eine immer intensivere Produktion als die einzige Alternative verkaufen, uns in Abhängigkeiten von großen Unternehmen bringen. Diese und ihre Vorgaben wiederum sind die Verantwortlichen dafür, dass wir uns alle – sei es im globalen Norden oder im globalen Süden – abstrampeln für einen Weltmarkt, der uns offensichtlich auf regionaler wie auf globaler Ebene nichts als Leid und Elend einbringt.
Die Agrarindustrie ist derart blind profitorientiert, dass in den stets kurzfristig gedachten Entscheidungen unter dem ausschließlichen Kriterium der Profitmaximierung auch der „Kollateralschaden“ solcher Entscheidungen derart verheerend sein kann, wie wir es derzeit erleben: Ein Virus ist – nicht von ungefähr – entstanden, eine Pandemie, die unabsehbar viele Menschen das Leben kosten kann. Covid-19 hat jetzt schon wirtschaftliche Folgen, die selbst diese Profite und – viel wichtiger! – alles, was unsere Leben angeht, umfassend in Frage stellt. Solange „der Laden“ ungestört durch das Virus lief, wurden die externalisierten Kosten quasi klaglos und unbemerkt getragen von den Tieren, der Umwelt, den landwirtschaftlichen ArbeiterInnen, den KonsumentInnen, dem Staat, dem Gesundheitswesen und vielen mehr. Sie wurden bisher nie den landwirtschaftlichen Betriebskosten zugerechnet, und die Verantwortlichen mussten nie dafür aufkommen. Wäre dies geschehen, würde es diese Form der Agrarindustrie überhaupt nicht geben. Das wird auch jetzt mit den immensen Kosten, die der Corona-Ausbruch verursacht, nicht der Fall sein. Die werden am Ende wir schultern müssen.
Umso mehr sollten wir die derzeitige Krise zumindest als Chance sehen, diese Ungerechtigkeiten ein für alle Mal in Frage zu stellen und nach Wegen zu einer tiefgreifenden Veränderung zu suchen – gemeinsam.
Rassistische Ausgrenzungen können in dieser Diskussion keinen Raum haben. Wer sich darauf einlässt, hat strukturell nichts verstanden, ganz abgesehen davon, dass er die Gewalt, die Rassismus darstellt, billigend in Kauf nimmt. Gesunde Lebensbedingungen, gute Lebensmittel und medizinische Versorgung sind ein Recht für alle. Hinzu kommt, dass der Virus diese Grenzen nicht kennt. Wer also in diskriminierender Ausgrenzung andere verdrängen will hat nicht verstanden, dass die Gefahr somit selbst zu erkranken exponentiell damit steigt, desto schlechter diese „anderen“ in unserer globalen Gesellschaft versorgt sind. In Bezug auf Krankheiten und Epidemien wurden und werden immer wieder marginalisierte Menschen stigmatisiert, Opfer von Angriffen oder in der systembedingt unvermeidlichen barbarischen Konkurrenz um die knapper werdenden Ressourcen als Bedrohung dargestellt. Um es kurz in Bezug auf einige der Infektionskrankheiten der jüngeren Geschichte aufzuzeigen: Anti-chinesischer Rassismus im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie ist ebenso falsch, wie es richtig ist daran zu erinnern, dass die verschiedenen Vogel- und Schweinegrippen ihren Ursprung in Europa und den U.S.A. hatten und auch hier die Regierungen die Agrarindustrie, die dafür verantwortlich war, gedeckt haben. Regional ausgebreitete Krankheiten wie Ebola in West-Afrika und Zika in Brasilien wurden durch post-kolonialistische Armuts- und Abhängigkeitsverhältnisse der multinationalen Ausbeuter maßgeblich begünstigt.
Unsere eigene Regierung sträubt sich mit aller Macht gegen ein Lieferkettengesetz, das die Ausbeutung durch deutsche Unternehmen im Ausland der Strafbarkeit zuführen würde. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Produkte, die unter diesen Bedingungen produziert werden, auch weiterhin unseren Markt bestimmen und heimische ProduzentInnen gegen diese billigen Preise konkurrieren müssen, daran aber betriebswirtschaftlich zerbrechen.
Dies ist genau eines der Beispiele dafür, dass uns über alle Grenzen des Globus und alle Unterschiede der Lebensumstände und Arbeitsbedingungen hinweg mehr eint als trennt. Die Länder des globalen Nordens und ihre Menschen waren lange die Gewinner dieser Ausbeutungsverhältnisse, aber die Not der LandwirtInnen und der Menschen, die auch hier zunehmend in prekarisierten Arbeitsverhältnissen schuften müssen, zeigen, dass diese Ungerechtigkeit auch im globalen Norden rasant zunimmt. Marginalisierung gegen Marginalisierung auszuspielen, ist ein platter Versuch, uns zu trennen. Wir werden das nicht zulassen.
Dieselben Regierungen, die mit Hilfe der Arbeitgeberverbände seit Jahren das Lieferkettengesetz verhindern und Freihandelsabkommen wie Mercosur anstreben, sind es auch, die nun im Rahmen des geplanten Agrarpakets sofort ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen die LandwirtInnen durchsetzen wollen, ohne ihnen hinreichend Zeit einzuräumen und einen Gestaltungsrahmen dafür zu schaffen, dass die Betriebe den Wandel überhaupt leisten können. Schutz vor Überdüngung und einem hohen Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln ist für eine zukunftsorientierte Landwirtschaft unerlässlich. Das steht außer Frage. Jedoch ist es zynisch, wenn die Politik das System, das sie über Jahrzehnte im Interesse der Agrarindustrie installiert hat, nicht in Frage stellt und erwartet, die LandwirtInnen sollten und könnten es alleine richten.
Um ein regionales Beispiel zu bringen und es in den Kontext der Corona-Krise zu stellen:
Wie wollen wir damit umgehen, wenn jetzt bestimmte Produkte knapp werden, wir aber als Gesellschaft wissen, dass ein kurzfristiger Schutz vor der Ausbreitung des Corona-Virus am besten zu bewerkstelligen ist, wenn sich Menschen und Produkte nicht ständig von Region zu Region bewegen? In unserer Region wird eine ganze Palette von Produkten schon lange nicht mehr angebaut, weil die Weiterverarbeitung fehlt. Obst, Gemüse, Hackfrüchte wie die Kartoffel. Wir importieren den Großteil. Deutschland baut nur 27 % des eigenen Gemüsebedarfs an, weil Gemüseanbau händische Arbeit bedeutet, oft einen hohen Einsatz an Pflanzenschutzmitteln und alles das viel billiger und mit viel weniger Auflagen im Ausland umgesetzt werden kann. Wir haben uns ein System geschaffen, in dem alles das einfach importiert wird, wenn es die kurzfristigen Gewinne steigert. Diese Ausbeutungsstrukturen betreffen jetzt schon die marginalisierten ArbeiterInnen, die in Südspanien für einen Großteil der europäischen Gemüseproduktion auch für deutsche Supermarktregale arbeiten. Durch die Corona-Krise steigt der Arbeitsdruck auf sie gerade ins unermessliche, es wird von Arbeitstagen von weit über 15 Stunden berichtet. Arbeitsrechtliche Kämpfe durch die Gewerkschaften wurden dort gerade wegen Corona ebenso unterbrochen, wie bei den streikenden in der Berliner Charité. Arbeitsschutz durch einzuhaltende Abstände und Schutzmasken gibt es auch für die in den Packhallen Tätigen nicht. Werden sie krank, könnte unsere seit Jahren fehlende Solidarität in Form eines dann stockenden Warenflusses oder steigenden Infektionszahlen auch Auswirkungen auf uns haben. Sind die Menschen krank, die mit den Produkten in Kontakt sind, die wir zum Leben brauchen steigt auch unser Risiko zu erkranken. Auch die Ausfälle, die es in den heimischen Sonderkulturen aufgrund von nicht verfügbaren (billigen) SaisonarbeiterInnen aus dem Ausland geben wird, werden unsere Region stark treffen. Gerade wurde ein Agrarpaket durch die Bundesregierung beschlossen, dass zwar die Relevanz dieser Arbeitskraft anerkennt, aber ihr begegnet indem sie weitere Lockerungen im Arbeitnehmerschutz veranlasst hat. Jetzt ist es erlaubt, Saisonkräfte bis zu 5 Monate sozialversicherungsfrei anzustellen. Gebraucht wäre ein Paket, was Betriebe finanziell unterstützt, Menschen ordentlich anzustellen. Wann wird ein Umdenken stattfinden und arbeitenden Menschen endlich Anerkennung und Solidarität zuteil? Wie sollen wir als regionale LandwirtInnen nun schnell Strukturen schaffen, die sicherstellen, dass unsere Region versorgt ist? Das aber ist unsere Aufgabe, die wir mit Stolz und Leidenschaft erfüllen wollen und werden.
Wir müssen versuchen sicherzustellen, dass auch in einer möglichen Krisensituation alle Menschen in der Bevölkerung Zugang nicht nur zu haltbaren Trockenwaren haben, sondern ebenso zu vitaminreichen frischen Produkten. Vor allem Obst und Gemüse liefern auch die lebenswichtige Immunkraft, bedeuten die wir mehr denn je brauchen. Sollten Importe ausfallen, werden diese Produkte knapp und es wird zuallererst die ärmeren Bevölkerungsgruppen treffen, die den Zugang dazu verlieren. Wir müssen diskutieren, wie wir sicherstellen, dass wir nicht nur profitorientiert entscheiden, wer was bekommt, sondern Strukturen schaffen, die auch auf Solidarität basieren.
Spätestens jetzt angesichts der Covid-19-Pandemie muss klar werden, wie wichtig die regionale Landwirtschaft ist. Die Krise muss zum Anlass genommen werden, kurzfristig sicherzustellen, dass Betrieben alle notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um weiter zu existieren und zu arbeiten. Dies muss auch durch gesicherte Abnahmepreise umgesetzt werden, sowie durch eine Schaffung von Weiterverarbeitungs- und Verteilstationen. TransportfahrerInnen und VerkäuferInnen die sich um die Distribution bemühen, müssen ordentlich entlohnt werden. Sie gehören ebenso wie die in der Reinigung, den Rettungsdiensten, in der medizinischen Versorgung und vielen anderen Bereichen arbeitenden zu denen, die dafür sorgen, dass wir alle durch diese schweren Zeiten kommen werden.
Langfristig muss klar werden, dass es regionale Wertschöpfung ist, die uns alle schützt. Es muss verstanden werden, dass die Grundlage unserer Ernährung, die landwirtschaftlichen Böden in die Hände von regionalen BäuerInnen gehören und nicht in die Hände von InvestorInnen und überregionalen oder nicht-landwirtschaftlichen Unternehmen. Dies muss für unsere Region gelten wie für alle anderen Regionen des Globusses (oder: alle anderen Regionen weltweit). Landwirtschaftliche Nutzflächen dürfen nicht Spekulationsobjekt sein, nicht hier und auch nicht im globalen Süden.
Wir brauchen ein agrarstrukturelles Leitbild und daraus folgende Konsequenzen, die dazu führen, dass eine Vielzahl junger, nachhaltiger und mittlerer Betriebe in unserer Region entstehen können. Wir brauchen eine gezielte Förderung für Ausbildungen im weiterverarbeitenden Lebensmittelhandwerk und Schaffung einer Vielzahl von Betrieben auch in diesem nachgelagerten Sektor. Es kann nicht sein, dass ein Fehlen für ganze Produktarten in der Weiterverarbeitung dazu führt, dass sie in der Region kaum noch auf dem Acker vorkommen. Es kann auch nicht sein, dass die Marktmacht von wenigen Molkereien oder Schlachtbetrieben dazu führt, dass die Versorgung der Bevölkerung im Zweifelsfall nicht sichergestellt ist oder die LandwirtInnen durch den aus der Konzentration resultierenden Preisdruck am Rande ihrer Existenz agieren.
Ebenso wie wir lokal agieren und global denken müssen, müssen wir es jetzt bei dem Ausbruch dieser bedrohlichen Erkrankung schaffen, kurzfristig solidarisch und langfristig solidarisch zu agieren. Langfristig heißt die Strukturfrage zu stellen und konkret anzugehen. Ansonsten wird es dabei bleiben, dass der Ausbruch von Covid-19 als isoliertes Geschehen behandelt und gesehen wird. Wir werden den Schmerz von Verlust und Trauer ertragen, wir werden im besten Fall gut aufeinander Acht geben und danach wird politisch und medial zum unspektakulären Alltag der Ungerechtigkeit zurückgekehrt -bis zur nächsten Katastrophe.
Kurzfristig heißt, zu sehen, wie wir uns nun als Gemeinschaft verhalten können. In Städten und Gemeinden entstehen jetzt schon nachbarschaftliche Initiativen zur gegenseitigen Unterstützung. Kinderbetreuung, Einkäufe, Fahrten und vieles mehr wird sich solidarisch angeboten.
Wir als LandwirtInnen der Region werden alles dafür tun, unsere Aufgabe in dieser Zeit für alle zu erfüllen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, werden wir sicherlich auch manche Unterstützung brauchen.
Wir brauchen die Einsicht, dass eine weitere schnelle Ausbreitung des Virus, wenn sie uns betrifft und krank macht, auch zu Arbeitsausfällen in unserem Sektor führen kann. Das wiederum würde die Versorgung der Region belasten. Es geht bei dieser Anmerkung also in keinem Fall darum, dass wir größeren Schutz als alle anderen fordern, oder in irgendeiner Form gefährdeter sind. Es geht aber darum, uns im Zweifelsfall zu überlegen, wie wir in allen Bereichen der Wertschöpfungskette von Produktion auf unseren Höfen, über Weiterverarbeitung bis hin zur Verteilung von Lebensmitteln das Ansteckungsrisiko möglichst gering halten zu können.
Es geht auch darum, im Zweifelsfall zu überlegen, wie wir unsere Betriebe aufrechterhalten können, wenn die Wirtschaft um uns herum zerfällt. Wir alle in der Region sind schon aufgrund der letzten Dürrejahre massiv unter Druck geraten und nicht zuletzt aufgrund einer jahrzehntelangen verfehlten Agrarpolitik. In Deutschland gehen jedes Jahr tausende Landwirtschaftsbetriebe verloren. Die letzten Monate waren gekennzeichnet von den berechtigten Protesten tausender LandwirtInnen. Wir werden ebenso wie das Reinigungspersonal in der Charité unsere Proteste einstellen, damit wir für die Lebensmittel sorgen können, wenn jetzt diese schwierige Situation auf uns alle zurast. Viele, die Landwirtschaft machen, arbeiten schon lange mit einer großen Portion Idealismus und Selbstausbeutung in diesem Bereich. Unsere Arbeit wird als selbstverständlich genommen und ist es eigentlich schon lange nicht mehr. Sollte es durch den Ausfall von Importen zu Lebensmittelengpässen kommen, werden wir alles tun, um weiterhin und erst recht gute Lebensmittel für die Menschen in unserer Region zu produzieren.
Ich hoffe im Namen meines gesamten Berufsstandes sprechen zu können, wenn ich sage wir werden uns nicht in einer Situation von Mangel dazu hinreißen lassen, unsere Produkte nur noch Menschen mit den entsprechenden finanziellen Mitteln zugänglich zu machen. Wir werden dafür einstehen, dass Lebensmittel allen Menschen gleichermaßen zukommen, egal welchen Hintergrund an finanziellen Möglichen, Herkunft, Bildung, Sprache oder Kultur sie haben. Wir werden aus Solidarität arbeiten und nicht gewinnorientiert. Im Ernstfall werden wir noch dringlicher als ohnehin schon überlegen müssen, wie wir den sozialen Fragen rund um die Preise und Erreichbarkeit von Lebensmitteln begegnen, aber wir werden die Unterstützung der Gesellschaft dafür brauchen (mit oder ohne Corona).
Solidarische Grüße an euch alle:
An die im medizinischen Sektor Tätigen, inklusive und explizit auch an das Reinigungspersonal und in ähnlichen Bereichen lebenswichtige Arbeit Leistenden; an MitarbeiterInnen im öffentlichem Verkehr; im Transportwesen; im Handwerk; an die LebensmittelverkäuferInnen und ApothekerInnen; an Menschen im Bildungssektor, die sich darum kümmern, dass Bildung weiterhin auch Online zur Verfügung steht; an Menschen in der Kinderbetreuung; an die undokumentierten ArbeiterInnen; an arme Menschen; an einsame Menschen; an immunschwache Menschen; an Menschen mit Vorerkrankungen und ältere Menschen; an Menschen, die in Zusammenhängen gefangen sind, wo soziale Distanz zum eigenen Schutz nicht möglich ist, wie in überfüllten Flüchtlingslagern oder in Gefängnissen; an Kinder, die ihre FreundInnen nicht treffen und womöglich bald ganz lange nicht raus kommen zum Spielen – und an ihre Eltern; an obdachlose Menschen; an Menschen die nun ohne Besuch in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Hospizen sind; an Menschen die an Corona erkranken und Menschen die Menschen in dieser Zeit verlieren, die sie lieben; an die Menschen die durch diese Situation in den finanziellen Ruin stürzen; an die Menschen, die psychische Erkrankungen haben oder mit der Angst, die so eine Situation verbreitet, ganz schwer umgehen können; an die ArbeiterInnen die gewerkschaftlich organisiert sind und die, die es nicht sind und natürlich ganz herzlich allen BerufskollegInnen in der Landwirtschaft. Julia Bar-Tal, Landwirtin aus Märkisch-Oderland, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft Brandenburg.
Die Autorin Julia Bar-Tal ist für die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V.
Brandenburg (The Work Group on Rural Agriculture, Brandenburg) aktiv.